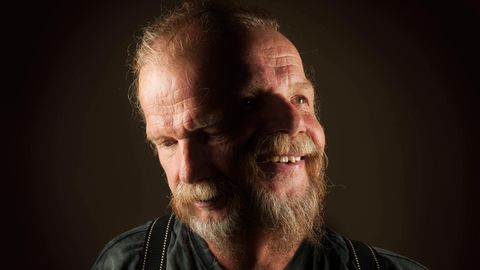Fußball ist ein Kontaktspiel. Spieler:innen prallen im Kampf um den Ball aneinander, stürzen, verletzen sich. So wie Christoph Kramer im Finalspiel der Fußballweltmeisterschaft 2014. Kramer hatte sich im Zweikampf den Kopf gestoßen, wirkte orientierungslos, spielte aber dennoch erst einmal weiter – bis es nicht mehr ging. Erst später stellte sich heraus, dass er eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. Der Fall Kramer ist einer der bekanntesten, aber kein Einzelfall.
Der Weltfußballverband Fifa hat inzwischen reagiert. Bei der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen beobachten nun erstmals sogenannte "Concussion Spotter" die Spiele und halten Ausschau nach möglichen Gehirnerschütterungen. Bei Verdacht verständigen sie das medizinische Personal. Ein Überblick darüber, was Gehirnerschütterungen so gefährlich macht und warum Frauen von den neuen "Spähern" besonders profitieren.
Was ist eine Gehirnerschütterung?
Eine Gehirnerschütterung wird durch eine Kopfverletzung verursacht, beispielsweise durch Zusammenstöße und Stürze beim Sport. Sie wird auch als leichtes Schädel-Hirn-Trauma bezeichnet. Durch die Gewalteinwirkung auf den Kopf kommt es "zu einer meist kurzen manchmal aber auch länger andauernden Funktionsstörung beziehungsweise neurologischen Störung des Gehirns", wie in einer Handlungsempfehlung des Bundesinstituts für Sportwissenschaft zu Schädel-Hirn-Traumas nachzulesen ist. Vereinfacht ausgedrückt, führe "die Gehirnerschütterung in dem normalerweise geordneten Wirrwarr von Nervenzellen und elektrischen Leitungen [im Gehirn] zu einem kleineren oder größeren Kurzschluss. Verbindungen zwischen einzelnen Nervenzellen können dabei abreißen."
Welche Symptome treten bei Gehirnerschütterungen auf?
Symptome treten meist kurz nach der Verletzung auf, es kann aber auch bis zu 48 Stunden dauern. Zu den typischen Symptomen gehören Kopfschmerzen, Gedächtnisstörungen, Übelkeit, Erbrechen, Benommenheit. "Ursache der typischen Symptome einer Gehirnerschütterung ist eine mechanische Reizung der Nervenfasern, die mit einem vorübergehenden Funktionsverlust dieser einhergehen kann", klären die Neurologen und Psychiater im Netz auf.
Kopfverletzungen sollten grundsätzlich (not-)ärztlich untersucht werden, bei einer Gehirnerschütterung dauert die Überwachung meist 24 Stunden. Dies ist wichtig, da es durch Schädel-Hirn-Traumas zu Hirnblutungen und -quetschungen kommen kann. Nach einer Gehirnerschütterung ist eine körperliche wie geistige Ruhephase von ein bis zwei Tagen wichtig. Eine Gehirnerschütterung heilt meist binnen weniger Tage vollständig ab. Aber eben nicht immer.
Welche langfristigen Folgen können Gehirnerschütterungen haben?
Im Regelfall klingen die Symptome vollständig ab, das Gehirn erholt sich gänzlich. "Bei bis zu 30 Prozent der Betroffenen aber nicht, man nennt sie daher die 'miserable minority'. Sie können über Monate oder Jahre Symptome wie Kopfschmerzen, Konzentrations- und Schlafstörungen, depressive Verstimmungen haben", so Inga Koerte, Professorin für Neurobiologie.
Eine Studie, die im Auftrag des englischen Fußballverbands und der Professional Footballers' Association von der Universität Nottingham durchgeführt wurde, fand heraus, dass für Profifußballer das Risiko an einer Demenz oder einer anderen neurodegenerativen Erkrankung wie Alzheimer zu erkranken, fast dreieinhalb mal so hoch ist wie in der Allgemeinbevölkerung (2,8 Prozent/0,9 Prozent).
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Gehirnerschütterungen und CTE?
Die Wissenschaft geht derzeit davon aus, dass die chronisch-traumatische Enzephalopathie (CTE), auch als Boxerkrankheit bekannt, unter anderem durch wiederholte Kopfverletzungen wie Schläge oder Stöße verursacht wird. Es handelt sich bei CTE um eine neurodegenerative Krankheit, bei der Nervenzellen absterben. Zu den Symptomen gehören Demenz, Depressionen, Suizidalität. Nachgewiesen werden konnte die Krankheit inzwischen bei hunderten Profisportlern, darunter auch Fußballprofis.
Wie oft kommt es im Sport zu Gehirnerschütterungen?
Laut Bundesinstitut für Sportwissenschaft erleiden in Deutschland jedes Jahr 270.000 Menschen eine Schädel-Hirn-Verletzung, der überwiegende Teil kann demnach als leicht eingestuft werden. Valide Zahlen speziell zur Gehirnerschütterung gibt es derzeit nicht. Man gehe von 40.000 bis 120.000 Gehirnerschütterungen aus, die hierzulande in Notaufnahmen behandelt werden. Mindestens 44.000 Menschen haben sich die Gehirnerschütterung beim Sport zugezogen, dazu kommen die nicht-dokumentierten Fälle, die als "weitaus höher" eingeschätzt werden. "Speziell bei Kontakt-Sportarten ist mit 5 bis 15 Prozent Gehirnerschütterungen bezogen auf alle erlittenen Verletzungen zu rechen", so das Bundesinstitut für Sportwissenschaft.
Wie häufig sind Gehirnerschütterungen bei Fußballerinnen?
Wie oft es beim Sport zu Gehirnverletzungen bei Frauen kommt, ist nicht klar. Wie so oft besteht auch bezüglich solcher Untersuchungen ein "Gender Data Gap". Das heißt, dass sie hauptsächlich unter männlichen Sportlern durchgeführt werden. Dabei sind Sportlerinnen wahrscheinlicher von solchen Verletzungen betroffen. Die "American Academy of Neurology" gab bereits 2017 an, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich Sportlerinnen bei Sportarten wie Fußball eine Gehirnerschütterung zuziehen, um 50 Prozent höher ist als bei männlichen Athleten.
Der Leitfaden "Gesundheit und Fitness für Fußballerinnen" der Fifa, spricht davon, dass Frauen mehr Kopf- und Kniebänderverletzungen als Männer erleiden. 17 Prozent der Verletzungen von Fußballerinnen entfallen demnach auf den Kopf. Im Rahmen einer kleinen Studie des Nachwuchsförderzentrums für Juniorinnen an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU), wurden 127 Fußballerinnen im Juniorinnen-Alter zu ihren Verletzungshistorien befragt. Es handelte sich um Athletinnen, der zweiten bis vierten Frauenligen. Jede sechste Spielerin berichtete dabei von einer Gehirnerschütterung als Erst- oder Zweitverletzung.
Äußern sich Gehirnerschütterungen bei Frauen anders als bei Männern?
Inga Koerte ist Professorin für Neurobiologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und der Harvard Medical School in Boston. Sie gilt als Koryphäe, wenn es um Kopfverletzungen geht. Im LMU-Forschungsmagazin "Einsichten" erklärt Koerte, dass durch eine Studie gezeigt werden konnte, "dass nach wiederholten Kopferschütterungen bei Frauen auch mehr Veränderungen im Gehirn nachweisbar sind". Studien legten außerdem nahe, dass auch die Symptome, die Frauen in Folge einer Gehirnerschütterung erleiden, stärker, vielfältiger und langanhaltender sind als die von Männern. Frauen zeigten demnach eher Verhaltenssymptome, berichteten häufiger von Schwierigkeiten, Beziehungen aufrecht zu erhalten. Bei Männern handele es sich eher um neurologische Symptome wie Kopfschmerzen oder Schwindel, führte sie im Gespräch mit "Süddeutsche Zeitung" weiter aus.
Diese Gerichte steigern die Lebensqualität von Demenzerkrankten
Für 2 Personen
Zubereitungszeit: 25 Minuten
Zutaten:
200 g Zuckererbsenschoten
1 rote Paprikaschote
300 g Champignons
2 Zwiebeln
300 g Putenschnitzel
2 EL Olivenöl
Salz, Pfeffer
edelsüßes Paprikapulver
1. Die Zuckererbsenschoten putzen und waschen. Die Paprika putzen, waschen und fein würfeln. Champignons putzen, trocken mit einem Küchentuch abreiben und vierteln. Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden. Die Putenschnitzel waschen, mit Küchenpapier trocken tupfen und in dünne Medaillons schneiden.
2. 1 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und Fleischstücke darin 2–3 Minuten von beiden Seiten braten. Mit Salz und Pfeffer würzen, aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen.
3. In der gleichen Pfanne das restliche Olivenöl erhitzen und die Zuckerschoten, die Zwiebeln und die Paprikawürfel darin 5–6 Minuten braten. Die Champignons dazugeben und weitere 3–4 Minuten garen. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver abschmecken.
4. Das Fleisch zufügen und abschließend in 2–3 Minuten fertig braten. Zum Servieren Putenpfanne mit frischen Thymianblättchen bestreuen.
Was ist der Grund für diese Unterschiede?
Die Gründe dafür sind vielfältig. Hormone sind wohl einer davon. So gibt eine Studie der University of Rochester Hinweise darauf, dass die Folgen einer Gehirnerschütterung auch davon beeinflusst werden, in welcher Phase des Menstruationszyklus' die Frau ist. So seien Frauen nach einer Gehirnerschütterung "schlechter beieinander" und brauchten länger, um sich zu erholen, wenn die Gehirnerschütterung in der zweiten Zyklushälfte stattfand, so Koerte in "Einsichten". Hormonelle Verhütungsmittel könnten laut Studie ein probates Gegenmittel sein. Neben hormonellen Unterschieden spielten laut der Neurobiologin sicherlich auch Faktoren wie genetische Unterschiede und Unterschiede im Verletzungsmuster eine Rolle.
Auch die Hirnstruktur selbst könnte einen Unterschied machen. "Die Axone, also die Fortsätze der Nervenzellen im Gehirn, sind bei Frauen dünner und weniger stabil. Wenn man an den Axonen zieht, reißen sie bei Frauen schneller als bei Männern", erläutert Koerte im Gespräch mit dem "Spiegel". Es ist also möglich, dass Verletzungen des Kopfes wie Stöße bei Frauen nicht nur schneller zu Gehirnerschütterungen führen, sondern auch gravierendere Auswirkungen auf das Gehirn haben. Zudem arbeiten Gehirne von Frauen anders als die von Männern, so kommunizieren die beiden Gehirnhälften mehr miteinander. Bei Schädel-Hirn-Traumata wird diese Verbindung aber häufig verletzt.
Aus weiteren Untersuchungen gibt es Hinweise, dass auch die körperliche Konstitution eine Rolle spielen könnte. Demnach hätten männliche Sportler im Vergleich zu weiblichen ihr Genick bei Erschütterungen besser stabilisieren können. Ein gezieltes Training der Nackenpartie könne, so ein Schluss aus der Studie, das Verletzungsrisiko bei Frauen senken.
Können Kopfbälle wirklich Schäden im Gehirn anrichten?
Koerte und Kolleg:innen der Ludwig-Maximilians-Universität in München und der Harvard Medical School untersuchten im Rahmen einer kleinen Studie, ob Kopfbälle, also eher leichte Kopferschütterungen, schädlich für das Hirn sind. Untersucht wurde das an Gehirnen von zwölf Fußballprofis eines großen Vereins. Dabei konnte das Forscherteam unter anderem nachweisen, dass es "auch ohne akute Symptome zu Veränderung des Gehirns kommen kann", wie Koerte gegenüber "Die Zeit" erläuterte.
Die Forschenden fanden großflächige Veränderungen, vor allem in den Arealen, die unter anderem für das Gedächtnis und Aufmerksamkeit zuständig sind. "Wir fanden eine erhöhte Diffusion, die auf dünnere Myelinscheiden hinweisen kann. Werden sie dünner, ist die Leitung nicht mehr so schnell. Das könnte erklären, warum sich Gehirnfunktionen verschlechtern", so Koerte. Sie hoffe, dass dadurch auch in Deutschland das Bewusstsein für mögliche Gehirnschädigungen durch Sport wächst. Erste Schritte sind getan. Im März 2023 unterzeichneten die Proficlubs der ersten und zweiten Bundesliga ein einheitliches Protokoll zum Umgang mit Kopfverletzungen von Spielern im deutschen Profifußball.
Quelle: Neurologen und Psychiater im Netz, IQWiG, gesund.bund, Bundesinstitut für Sportwissenschaft, Studie der Universität Nottingham, LMU, Süddeutsche Zeitung, University Rochester, Spiegel , Informationsdienst Wissenschaft, FIFA, UEFA, Die Zeit, SRF, DFL-Broschüre Kopfverletzungen